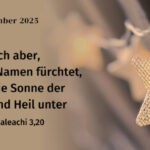Die Macht der Musik
Zu Pfingsten hatten Dr. Marco Lemme (Orgel) und Hans Jacob (Trompete) ein unterhaltsames Konzert in unserer Kirche gegeben. Das gut gewählte Programm umfasste Musik von Barock bis zur Moderne. Das Publikum war begeistert und dankte Marco Lemme auch für seine netten Worte und Hans Jacob für die Präsentation und Erklärung zu seinen vier verschiedenen Blasinstrumenten.
Ich hatte dieses angekündigte Konzert mit großer Freude und Spannung erwartet; denn es hatte in mir Erinnerungen wach gerufen, die über vierzig Jahre zurücklagen: Wir wohnten damals in Schönkirchen / Kiel als die Organistin unserer alten, schönen Feldsteinkirche ihren damals schon als Trompeter bekannten Studienfreund aus Dresden zu einem gemeinsamen Konzert eingeladen hatte. Es war für mich das erste und bis jetzt einzige Mal, dass ich ein Orgel / Trompeten Konzert gehört habe. Ich war damals ganz begeistert von der Musik und dem Klang, den diese beiden majestätischen Instrumente zusammen erzeugt hatten. Ja, daran erinnerte ich mich, aber nicht an den Namen des Trompeters. Bei einem Gespräch mit Hans Jacob half er mir auf die Sprünge: „War es vielleicht Ludwig Güttler?“ Ja, natürlich, das war sein Name! Inzwischen weiß ich, Ludwig Güttler hat auch viele Konzerte gegeben und auf die Gagen verzichtet, womit er den Wiederaufbau der,bei dem furchtbaren Angriff auf Dresden 1943 zerstörten Frauenkirche finanziell unterstützt hatte. Seine Laufbahn als Hochschullehrer, Solist und Dirigent in In- und Ausland hat Prof. Ludwig Güttler mit zwei Konzerten an der Frauenkirche 2022 beendet.
Diese Erinnerungen haben mich nachdenklich gemacht. Was ist Musik? Was bewirkt sie? Wir wissen, dass schon unsere Ahnen mit Gesang, Tänzen und Trommeln ihre Feste feierten oder die Götter beschworen. Das hat sich bis heute nicht verändert, Bei Hochzeiten und Beerdigungen darf die Musik nicht fehlen und besondere Sportveranstaltungen beginnen mit gemeinsamen Gesang.
Das früheste Instrument ist die menschliche Stimme, sie stand schon immer zur Verfügung. Denken wir an die Mutter, die durch ihren Sing-Sang ihr Kind beruhigt und in den Schlaf wiegt. Auch die ersten Schlaginstrumente, Klötze zum Trommeln und Krach machen, gab es in jedem Kinderzimmer. Das sind die Grundelemente der Musik: Rhythmus und Tonhöhe, sie ordnen Zeit und Klang.
Den Griechen verdanken wir das Wort Musik, „musike“, es bezeichnet den antiken Versgesang. Andere führen „musike“ auf „die Kunst der Musen“ zurück; denn Qellnymphen und Göttinnen des Rhythmus und des Gesangs sollen die Urheber der Musik sein. Wir wissen, dass Musik die Kommunikation zwischen den Menschen fördert. Sie soll sie aber auch zwischen den Menschen und den Göttern fördern.
Die ersten Instrumente waren Flöten, Trommeln, danach die Saiteninstrumente. Im alten Griechenland gab es Zimbeln und das Tympanum, eine Art Trommel, und die „Kithara“. Erst durch Fortschritte in der Metallindustrie entstanden die ersten Hörner.
Die ersten musiktheoretischen Schriften entstanden unter Aristoteles und Euklid. Man entwickelte das System der Tonleitern und eine Notenschrift. Von nachhaltiger Wirkung war die Harmonielehre des Pythagoras (570-497 v.Chr).
In der Frühzeit der griech, Antike herrschte der vom Saitenspiel (der Lyra) begleitete Gesang der Heldenerzähler. Die antiken Tragödien zogen einen Großteil ihrer Wirkung aus der Musik, wobei der Chor im Wechsel mit den Solisten auftrat. Unser Wort „Orchester“verdanken wir dem griech.“orchestra“, dem halbrunden Bereich vor der Bühne, der später tief gelegt und zum Orchestergraben wurde.
Zwei Götter verkörpern für die Griechen die beiden unterschiedlichen Seiten der Musik: Apollon ist der Gott der Musik, der Dichtung, des Lichtes und der Wahrheit. Er ist Leierspieler, Führer und Kraft der Musik. Dionysos ist Gott des Tanzes, der Ekstase, des Rausches. – Die unterschiedlichen Wirkungen der Götter tauchen in vielen Konflikten der Musikgeschichte auf: geistliche gegen weltliche Musik, Vokalmusik gegen Instrumental- musik, häusliche Klaviermusik des Vaters gegen Rock-Gitarre des Sohnes.
Mittelalterliche Musik
In den Gottesdiensten der frühen Kirchen waren Instrumente gänzlich verboten. Man huldigte Gott in Hymnen: dem Palmensingen und dem Gregorianischen Choral. Dabei handelt es sich um einen einstimmigen religiösen Gesang in lateinischer Sprache, der heute auch noch zur katholischen Liturgie gehört. Bischof Ambrosius (4.Jh) hatte Hymnen geschrieben und war an der Entwicklung des abendländischen liturg. Kirchengesang beteiligt. Guido von Arezzo (922-1050) begann die Musik zu notieren, indem er die Tonhöhe auf Linien markierte. So konnte die religiöse Musik des Mittelalters aus Kirchen und Klöstern überliefert werden.
Die Hallwirkung der Kirche verstärkte den lateinischen Gesang und auch den Klang der Orgel später und demonstrierte dadurch die Allmacht Gottes. Die Orgel ist das größte Musikinstrument. Die älteste Orgel war die um 180 n. Chr. gebaute Wasserorgel. Das Cembalo wurde im 13.Jh .entwickelt. Es ist der Vorläufer des Hammerklaviers, das aus ihm und dem Klaviechord (14.Jh) entwickelt wurde.
In den Städten bildeten reiche Bürger „Singschulen“.In Deutschland waren es die „Meistersinger“, deren bekanntester Vertreter der Schuster Hans Sachs aus Nürnberg (1494-1576) war. Während die adligen „Troubadours“ und die „Minnesänger“ sich mehr der Kunst der Liebeswerbung widmeten, waren die Texte des bürgerlichen Lagers mehr Bibel – bezogen oder politisch-satirisch.
Die wichtigste musikalische Innovation in der religiösen Musik des M.A. war die Entwicklung der Mehrstimmigkeit. Bis zur Mitte des 13.Jh .sangen die Sänger nicht wie im Choral alle das gleiche, sondern nacheinander, aber verschiedene Melodien. Jetzt dachte man darüber nach, was sich gleichzeitig zusammen gesungen gut anhört. So entstand die Harmonielehre. Es dominierte die „Motette“. Mit dem musikalischen Barock entstand die erste große Oper von Claude Monteverdi (1576 – 1643) „Orfeo“. Die Opernstars dieser Zeit waren Kastrate.
Zugleich mit der Oper emanzipierte sich die Instrumentalmusik, sie wurde unabhängig. Musiker wurden zu Hofkünstler. Einer von ihnen war Antonio Vivaldi (1678-1741). Er war als Priester ausgebildet, notierte aber selbst während der Messe seine musikalischen Ideen und etablierte sich bald als höfischer Musiker.
Zur Grundlage der barocken Musik gehörte die „Affektenlehre“: Dur-Klänge stehen für Freude, Konsonanz und schnelles Tempo, Moll-Klänge für Trauer, Dissonanz und langsames Tempo. Georg,Friedrich Händel(1685-1759) hatte schon an der Seite Scalettis mit seinen Opern Italien erobert, als er zum Kapellmeister des Kurfürsten von Hannover ernannt wurde. Als dieser später als George I. den englischen Thron bestieg wurde Händel zum Star der Londoner Oper und schrieb seine Oratorien (Episoden aus biblischen Geschichten für Chor, Solisten und Orchester).
Aus Ouvertüren haben sich Sinfonien entwickelt und aus Tänzen entwickelten sich Suiten. In die Klassische Periode rechnen wir Joseph Haydn (1732-1809), der die Sinfonie als Orchestermusik und die Sonate für Klavier oder andere Instrumente und das Streichquartett entwickelt hat. Amadeus Mozart (1756-1791), das Wunderkind, das schon mit 5 Jahren komponierte, ist später Hofkomponist und dann freischaffender Künstler geworden.
Ludwig v. Beethoven (1770-1827) war das Urbild des freien Künstlers. Am bekanntesten sind seine Sinfonien und Klaviersonaten. Die berühmte „Ode an die Freude“ am Schluss seiner 9.Sinfonie zeigt, dass er sich niemandem als nur seiner Musik verpflichtet fühlt. Während Beethoven Sturm und Drang präsentiert, steht Franz Schubert (1797-1820) in der Romantik für bürgerliche Innigkeit. Er brachte Klaviermusik, seine Lieder und Streichquartette in die gute Stube der Bürger des Biedermeier.
Ich habe nur einige der vielen Musiker namentlich angeführt, um Beispiele dafür zu geben, wie durch die Künstler, aber auch durch äußere Einflüsse das Musikgeschehen verändert wird. Durch neue Stilrichtungen entstehen auch neue Musikinstrumente.
Musik wird auch zur Therapie eingesetzt. Schon in der Bibel wird von dem Hirten David berichtet, der durch sein Harfenspiel bei König Saul Schwermut und Trübsinn vertrieben hat. (1. Buch Samuel, Kap.16 Vers 23). Meine Physiotherapeutin erzählte mir von einem Parkinson Patienten, der jede Therapie Stunde mit einem gemeinsamen Tänzchen beginnen wollte. Eine Musiktherapeutin berichtet aus der Neurologie, dass ein 69 jähriger Mann infolge eines Schlaganfalls von schweren Sprachstörungen betroffen war. Er bekam Sprach- und Musiktherapie. Die Therapeutin sang einfache Lieder an, die der Patient fortsetzen sollte. Es entwickelten sich danach singende Fragen und Antworten. Die melodische Struktur im Lied ist das Gerüst, einen passenden Satz selbst hervorzubringen. Eine Musik- und Klangtherapeutin berichtet von einer 30 jährigen Patientin, die stationär in einer geschlossenen Abteilung war. Sie war redegesteigert, sprunghaft, ängstlich und hatte Probleme mit Körperkontakt, wollte kein Instrument anfassen, das andere berührt hatten. Dir Therapeutin schlug ihr eine Trommel vor, die sie mit Schlegeln bespielte. Die Patientin war interessiert, wurde ruhiger, wünschte sich Gitarre zu erlernen, probierte später auch das Keyboard. Nach 7 Stunden hatte die Angst abgenommen, sie hatte sich aus der sozialen Isolation gelöst und wurde zum Gruppenunterricht zugelassen.
Von einem 11jährigen Kind wird berichtet, dass es sich in sein Schneckenhaus zurück gezogen hatte und nicht mehr sprach. Durch Musiktherapie konnte ihm geholfen werden.
Musik mögen eigentlich alle Menschen. Viele spielen ein Instrument, singen gern oder sind sogar im Chor. Chorsingen macht Spaß und fördert die Kommunikation!
Hannelore Krause